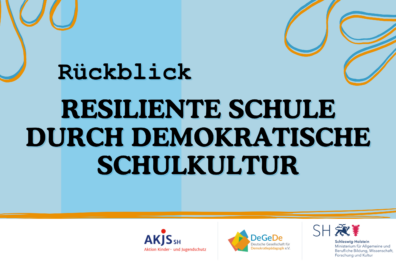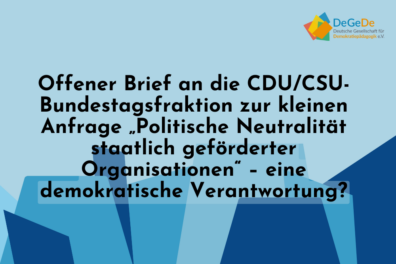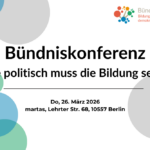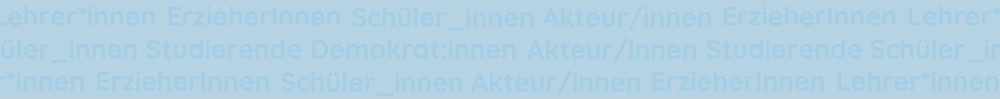
Seit dem 01. April 2024 herrscht an den bayrischen Schulen offiziell das Genderverbot. Es darf zwar weiterhin eine doppelte Ansprache genutzt werden, bspw. ‚Schülerinnen und Schüler’, in Schulaufgaben, Elternbriefen oder amtlichen Mitteilungen sind aber andere Formen, wie ‚Schüler*innen‘ oder ‚SchülerInnen‘ verboten. Die Regelungen weiten sich auch auf die öffentliche Verwaltung im Allgemeinen aus, wie beispielsweise Behörden oder Universitäten.
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat nun festgestellt, dass dieses Verbot verfassungsfeindlich sein könnte. In ihrem Kurzgutachten wird angemerkt, dass Jurist*innen befürchten, es bestehe „insbesondere die Gefahr, dass staatliche Einrichtungen verpflichtet werden, das Geschlechtsdiskriminierungsverbot (Artikel 3 GG) sowie allgemeine Persönlichkeitsrechte (Artikel 2 I in Verbindung mit Artikel 1 I GG) von Frauen, intergeschlechtlichen sowie nicht-binären Menschen zu verletzen“. Aber auch weitere Grundrechte könnten betroffen sein.
Bayern ist mit dieser Regel kein Sonderfall. Sachsen, Sachsen-Anhalt, Hessen und Schleswig-Holstein haben sämtliche Genderzeichen zu Rechtschreibfehlern erklärt.
Was ist Gendern und gendergerechte Sprache eigentlich?
Der Begriff gender kommt aus dem Englischen und wird im Deutschen meist mit soziales Geschlecht übersetzt. Technisch gesehen gendern wir in unserem Sprachgebrauch ständig, denn auch Schülerin oder Lehrer sind gegenderte Begriffe. Wir weisen ihnen sprachlich ein Geschlecht zu. Bayern hat demnach nicht das Gendern verboten, sondern nur eine bestimmte Form dessen: die Form, die Genderzeichen verwendet und in einem Wort explizit das gesamte Geschlechtsspektrum abdeckt. Genderfomen, die Genderzeichen verwenden, gehen also weg von biologischen Geschlechtsmerkmalen und Binärität (der Einteilung in nur zwei Geschlechter: Mann & Frau) und definiert Geschlecht stattdessen als soziales Konstrukt, das Raum für Geschlechtsdiversität lässt. Mit Genderzeichen gegenderte Begriffe umfassen also Frauen und Männer, aber auch Personen, die sich nicht in diese Kategorien einordnen.
Traditionell wird häufig das generische Maskulinum verwendet. Das bedeutet man nutzt die männliche Form – Lehrer – es sollen sich aber auch andere Personen angesprochen fühlen. Alternativ gibt es auch das generische Femininum – Lehrerin – das allerdings weitaus seltener verwendet wird. Die Nutzung dieser generischen Formen ist allerdings nicht neutral und damit auch nicht so generisch, wie sie dargestellt werden. Beispielsweise sprechen wir häufig von Ärzten und Kosmetikerinnen. Dass es auch Ärztinnen und Kosmetiker gibt, ist klar, aber die sprachliche Nutzung zeigt, welches Geschlecht wir welchem Beruf zuordnen. Und es zeigt sich die Tendenz, dass besser angesehenen und bezahlten Berufen häufig die männliche Form zugewiesen wird, während die weibliche Form meist in Bezug auf Service- und Care-Arbeit genutzt wird. Gleichzeitig werden Geschlechter, die aus dem traditionellen weiblich/männlich-Konstrukt herausfallen nicht mitgedacht. Viele Verfechter*innen des generischen Maskulinums führen immer wieder das Argument ins Feld, dass mit dem generischen Maskulinum ja auch alle angesprochen werden sollen, jedoch zeigen Studien, dass das so nicht funktioniert. Statistisch denken Personen bei der Nutzung der männlichen Form zunächst an Männer. Dieses Phänomen nennt sich auch männliche Verzerrung.
Welche Vorteile hat gendergerechte Sprache?
Dass wir inklusiver gendern hat eine ganze Menge Vorteile:
- Wir vermeiden die männliche Verzerrung. Das zeigt eine Studie.
- Es gibt mehr Geschlechter als nur männlich und weiblich. Das steht nicht zur Debatte. Das Gendern mit neutralen Formen oder Genderzeichen schließt diese Personen mit ein und signalisiert: Es gibt auch Personen in unserer Gesellschaft, die sich nicht in die Kategorien Mann und Frau einordnen lassen.
- Frauen bewerben sich mit höherer Wahrscheinlichkeit auf Jobausschreibungen, in denen gegendert wird. (Sie neigen übrigens auch dazu gendergerechte Sprache zu nutzen, wenn sie dieser ausgesetzt sind, anders als Männer.)
- Kinder entwickeln sich offener. Studien zeigen, dass Kinder, die mit gendergerechter Sprache erzogen werden, sich eher auch in Berufen sehen, die traditionell nicht mit ihrem Geschlecht in Verbindung gebracht werden. Mädchen entwickeln laut diesen Studien das Selbstbewusstsein klassische Männerberufe genauso kompetent ausführen zu können, wie ihre männlichen Mitmenschen. Auch dies wurde von Studien belegt.
Und ja, die Effekte des Genderns sind da. Sprache beeinflusst die Gesellschaft maßgeblich. Auch deren Wahrnehmung von Geschlecht. In Schweden hat die Einführung eines geschlechtsneutralen Pronomens die Toleranz gegenüber queeren Personen erhöht. Das belegt eine Studie. Dadurch kann sich auch das physische und psychische Wohlbefinden von queeren Personen steigern. Das ist wichtig, da sie wie viele andere Minderheiten unter Minderheitenstress leiden. Trans* Personen sind in Deutschland einem 8x höherem Suizidrisiko ausgesetzt. LGBTQIA+ Personen sind beinahe 3x häufiger von Depressionen betroffen als der*die Durchschnittsdeutsche.
Wie geht gendern nun eigentlich?
Fürs Gendern gibt es verschiedene Möglichkeiten.
- Unterstrich – Verwendung eines Unterstriches zur Trennung, z.B. Schüler_innen oder Lehrer_innen
- Schrägstrich – Verwendung eines Schrägstriches zur Trennung, z.B. Schüler/innen oder Lehrer/innen
- Doppelpunkt – Verwendung eines Doppelpunktes, z.B. Schüler:innen oder Lehrer:innen
- Binnen-I – Verwendung eines Binnen-Is, z.B. SchülerInnen oder LehrerInnen
- Genderstern – Verwendung des Gendersterns, z.B. Schüler*innen oder Lehrer*innen
- Neutrale Formulierungen – Für einige Begriffe gibt es auch einfach geschlechtsneutrale Begriffe, wie bspw. Lehrpersonen oder Studierende
Es gibt also eine weite Menge an Variationen, um zu gendern, zwischen denen sich entschieden werden kann. Was sie alle gemeinsam haben, ist, dass sie inklusiver sind als die Alternativen.
Was bedeutet dieses Genderverbot?
Betroffene Lehrkräfte haben seit der Beschließung des Gesetzes darüber gesprochen, welche Konsequenzen diese Regelung für sie hat und welche Bedeutung sie darin sehen. Viele von ihnen auf Empfehlung ihrer Gewerkschaft ohne Klarnamen. Die Preisgabe dieser könnte dienstrechtliche Folgen haben. Aber auch von anderen Seiten hagelt es Kritik gegen das Genderverbot und Zuspruch zur Sinnhaftigkeit des Genderns.
Bayerische Lehrkräfte merken unter anderem an, dass das Genderverbot diskriminierend ist. Es schließt queere Personen aus dem schulischen Sprachgebrauch aus. Sie werden auf dem Papier und im Sprachgebrauch „einfach wegradiert”. Dabei ändert das Genderverbot ja nichts an der Existenz von beispielsweise nicht-binären Personen. Es ist realitätsfremd diese Personen auf dem Papier zu verschweigen, besonders wenn statistisch bis zu 1% der Bevölkerung nicht-binär ist. Diese Zahl wird in den jüngeren Generationen tendenziell höher, was häufig einer stärkeren Auseinandersetzung mit dem Thema und dem Begriff zugeschrieben wird. Man kann sich nur als etwas identifizieren, was man auch kennt. Einige der bayrischen Lehrkräfte stellen zu Recht die Frage: „Und wie kann ich mich nach den Ferien in den Unterricht stellen und meinen Schüler*innen ins Gesicht sagen: Es tut mir leid, ihr seid jetzt verboten, weil ihr uns zu kompliziert seid.“
Auch die Bundesschülerkonferenz spricht sich gegen das Genderverbot aus und nennt es bevormundend. Laut ihnen sollte es freigestellt sein, ob Personen im schulischen Kontext gendern wollen oder nicht.
Das Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultur teilt mit, dass die Verwendung von Genderzeichen keinen Einfluss auf Noten haben soll, Schüler*innen sind also von dem Verbot ausgenommen. (Was Lehrkräfte, die das Genderverbot befürworten natürlich nicht davon abhalten wird es auch für Schüler*innen durchzusetzen, jetzt mit einem neuen Selbstbewusstsein, gewonnen durch die Bestätigung ihrer Meinung durch das neu verabschiedete Gesetz.) Die Konsequenzen für Lehrkräfte sollen währenddessen in jedem Einzelfall gesondert beschlossen werden. (Dass das zu staatlich unterstützter Willkür führen wird, ist unfraglich.)
Wenn man fragt, auf welcher Grundlage die bayerische Regierung das Genderverbot eingeführt hat, heißt es, gendergerechte Sprache sei exkludierend. Sie sei laut Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) ideologisch geprägt und werde zu häufig ‚missionarisch verwendet’. Dies sei nicht mit einer offenen Gesellschaft vereinbar. (Die Exklusion von gendernonkonformen Personen wird allerdings in Kauf genommen. Genauso wie die von Frauen, von welcher die oben genannte Studie berichtet, denn die ausschließliche Nutzung des generischen Maskulinums ist nicht verboten. Trotz der oben aufgeführten Studien.) Außerdem wird auf eine Empfehlung des Rates für deutsche Rechtschreibung verwiesen. Dort heißt es: Gendern könne die Verständlichkeit von Texten verschlechtern. Gleichzeit sei die Entscheidung unabhängig von zukünftigen Entscheidungen des Rates. Sollte der Rat für deutsche Rechtschreibung sein Urteil zum Thema gendern also ändern, soll das keinen Einfluss auf die Genderpolitik in Bayern haben. Auch gibt es eine Reihe von Studien, die angeben, dass das Gendern die Verständlichkeit von Texten nicht maßgeblich verändert, weder im akademischen noch im professionellen oder allgemeinen Sprachgebrauch (bspw. Friedrich & Heise 2019).
Eine sprachliche Gewöhnungsphase ist normal und wird am schnellsten vonstattengehen, wenn die neuen Generationen sprachliche Neuerungen bereits im jungen Altern erlernen, wie eben in der Schule. Natürlich kann in diesem Kontext nicht unerwähnt bleiben, dass gendergerechte Sprache für einige Personen größere Herausforderungen birgt als für andere. Personen mit Lernschwächen und niedrigerem Sprachlevel haben häufig mehr Probleme Texte, die bestimmte Formen des genderns nutzen, zu verstehen. Allerdings zeigt diese Studie, dass Optionen wie der Genderstern mit einer Erklärung durchaus gut verständlich sind. Und diese Art der Einführung könnte einfach ein grundsätzlicher Teil jedes Deutschkurses werden. Auch diese können sich an Sprachneuerungen anpassen. Die weibliche Form war beispielsweise auch noch nicht immer im Sprachgebrauch vorhanden. Heute können wir uns die deutsche Sprache ohne kaum noch vorstellen.
Und das gleiche könnte in der Zukunft auch für eine gendergerechte Sprache gelten. Eine Sprache, die alle einschließt und Willkommen heißt. Eine Sprache, die nicht diskriminiert.
Janika Stolt für die DeGeDe
Als DeGeDe haben wir uns bereits vor einigen Jahren entschieden zu gendern und dazu einen Gender-Hinweis veröffentlicht.
Bei Interesse ist der Artikel auch hier als PDF verfügbar.