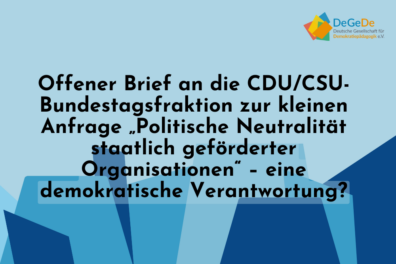Am 15. September ist der Internationale Tag der Demokratie – ein Tag, der dafür gedacht ist uns die Prinzipien und Grundlagen der Demokratie vor Augen zu führen. In Deutschland fällt er zwischen die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen am 01.09. und die in Brandenburg am 22.09.
Und während das vielleicht besonders demokratisch klingt – ein Tag der Demokratie direkt zwischen drei demokratischen Wahlen – haben diese Wahlen einen besonderen Beigeschmack und sollten uns vor allem an eine Sache erinnern: Demokratie ist kein Naturgesetz. Wir können sie auch wieder verlieren.
Das ist von Relevanz, da eine vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestufte Partei Rekordergebnisse erreicht hat. In Sachsen liegt die Alternative für Deutschland (AfD) ganz knapp auf dem zweiten Platz. In Thüringen konnten sie sogar den Wahlsieg einfahren. Und auch in Brandenburg ist laut Hochrechnungen ein Wahlsieg für die AfD möglich. Dabei handelt es sich bei der AfD um eine Partei, die regelmäßig auch als demokratiegefährend wahrgenommen wird.
Vielleicht ist der Tag der Demokratie in dieser Zeit also eine Erinnerung daran, dass wir auf unsere Demokratie aufpassen müssen. Eine Warnung, dass um Demokratien gekämpft werden muss.
Historische Kämpfe um Demokratie
Demokratie in einem anderen System zu erkämpfen ist historisch der beinahe einzige Weg zu dieser zu gelangen. Demokratie entsteht nicht einfach aus dem Nichts und Personen, die Macht in sich vereinen, wollen diese nur selten an eine breite Masse abgeben. Ein Umstand, der im Fall von 1848/49 deutlich wird, als das erste deutsche Parlament entstand und tagte. Die Zustimmung ein Parlament zuzulassen erfolgte aufgrund von aufgebautem Druck durch die Bevölkerung. König Friedrich Wilhelm sah in der Zustimmung ein Ventil, um der revolutionären Grundstimmung etwas Wind aus den Segeln zu nehmen. Als der Druck nachließ und König Friedrich Wilhelm eine Möglichkeit sah seine Machtposition zu erhalten, wandte er sich vom Parlament ab. Und die Hoffnungen auf ein demokratisches System wurde vorerst enttäuscht. Diese Dynamik, in der Demokratie im Kampf errungen wird, sorgt dafür, dass die Geschichte der Demokratie keine gradlinige ist. Stattdessen ist sie genauso von Erfolgen, wie von Rückschlägen geprägt.
Demokratiegeschichte lässt sich in zwei große Bereiche einteilen: Zum einen der Kampf für die Etablierung einer Demokratie innerhalb eines anderen Systems, wie es in den 1840ern der Fall war und zum anderen der Kampf für Demokratie innerhalb eines demokratischen Systems, wo freie Meinungsäußerung und Rechtstaatlichkeit bereits garantiert sind und es vornehmlich um die Formung und Weiterentwicklung der bestehenden Demokratie geht. Es handelt sich hierbei um zwei grundlegend verschiedene Kämpfe, die jedoch das gleiche Grundthema betreffen. Während erstere Art weitaus risikoreicher ist, ist uns die zweite weitaus vertrauter.
Weiter Kämpfen
Eine Gemeinsamkeit beider Wege für Demokratie einzustehen ist, dass sie nie das Ende sein können. Der Sturz einer nicht demokratischen Regierung ist erst der erste Schritt. Im Folgenden muss eine Demokratie sorgfältig errichtet werden. Während eine demokratische Verfassung und freie Wahlen den Anfang dieser Etablierung bilden, muss die Neugestaltung in die unteren Ebenen der Verwaltung und Gesellschaft weitergetragen werden. Nur so kann die Etablierung funktionieren. Dieser Schritt kann durch verschiedene Faktoren erschwert werden. Häufig haben die Demokrat*innen, die die Etablierung durchführen selbst keine Demokratieerfahrung. Wenn sie in dem Land aufwachsen, in dem sie nun die Demokratie etablieren wollen, haben sie selbst sehr wahrscheinlich noch nie eine funktionierende Demokratie erlebt. Es kommen auch immer wieder Personen aus demokratischen Systemen in andere Länder, um die dortigen Demokratiebestrebungen zu unterstützen. Dies hat allerdings zwei starke Nachteile. Zum einen kehren sie häufig nach der formellen Etablierung in ihre Heimat zurück. Gerade wenn sie in der Demokratiebewegung eine tragende Rolle innehatten, führt dies zu Problemen. Den zurückbleibenden Demokrat*innen fehlt dann nicht nur eine Führungsperson, sondern auch die Person, die tatsächliche Demokratieerfahrung mitbrachte. Doch selbst wenn sie bleiben, bleibt der Umstand, dass sie nicht in der Kultur des Landes aufgewachsen und sozialisiert sind, in dem sie nun Demokratie etablieren wollen. Ihre fehlende Vertrautheit mit der Mentalität und Identität eines Landes kann dazu führen, dass sie versuchen die Methoden zu kopieren, die in ihrer Heimat funktionieren und dabei die Besonderheiten des Landes ignorieren. Dabei sind kaum zwei Demokratien auf der Welt gleich.
Auch eine etablierte Demokratie muss verteidigt werden. Denn, dass ein demokratisches System bestehen bleibt ist keineswegs gegeben. Stattdessen sind historisch viele wieder gefallen. So sollte die Demokratie nach ihrer Etablierung nicht ruhen. Sie entwickelt sich stehts weiter und wird weiterentwickelt. Das liegt besonders an immer wechselnden Rahmenbedingungen. Wenn die Welt sich wandelt, muss die Demokratie das ebenfalls.
Kontinuierliche Anpassungen
Eine historisch sehr wandelbare Komponente der Demokratie ist die Definition der Wahlberechtigten. In unserem Verständnis ist die Beteiligung des Volkes an der Demokratie durch ihr Wahlrecht definiert. Damit ist die genaue Zusammensetzung der Wahlberechtigten bezeichnend dafür, wer Mitentscheidungsrecht hat. In der Revolution 1848/49 wurde in Deutschland erstmals ein Wahlrecht erkämpft. Dieses bezog sich auf einen großen Teil der erwachsenen männlichen Bevölkerung. Während es sich hierbei um einen wichtigen Punkt der deutschen Demokratiegeschichte handelte, blieb der Teil der Bevölkerung, der wahlberechtigt war, relativ gering. Einen weiteren großen Schritt machte die Einführung der Weimarer Republik. Unter ihr wurde 1919 das Wahlrecht auch für Frauen eingeführt. Damit stieg der prozentuale Anteil der Wahlberechtigten von 21,5% (1912) auf 58,5%. Heute können prozentual noch mehr Personen wählen. Die aktuelle Regelung in der BRD ist, dass Personen das 18. Lebensjahr (auf Landesebene nur das 16.) vollendet haben und eine deutsche Staatsbürgerschaft besitzen müssen. Das umfasste 2023 73,4% der deutschen Bevölkerung. Dennoch steigt die Größe einiger, von der Wahl ausgeschlossener, Gruppen stetig. Denn neben minderjährigen Personen dürfen auch Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft nicht an den Wahlen teilnehmen. Die Anzahl von Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft, die langfristig in Deutschland leben, steigt jedoch immer weiter an. 1925 umfasste diese Gruppe nur 1,5% der Bevölkerung. Innerhalb der nächsten 73 Jahre stieg der Umfang auf 8,6% (1998). 23 Jahre später lag er bei 13,1% (2021). Dieser Umstand kann die Überlegung anstoßen, ob es Zeit ist die Voraussetzungen für die Wahlberechtigung anzupassen.
Und damit öffnet sich die wichtige Erkenntnis, die wir aus der Demokratiegeschichte ziehen können. Ziele und Rahmenbedingungen ändern sich ständig und so muss sich auch unser Verhalten ändern. Sie lehrt uns, dass es notwendig ist Entscheidungen zu treffen. Weder die Demokratie an sich noch ihre Form sind ein Naturgesetz und die Demokratiegeschichte kann uns nicht lehren, wie wir uns zu verhalten haben. Es liegt in unserer Hand die Demokratie zu formen, zu gestalten und an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Es gilt also sich dem Gedanken zu stellen welche Art der Demokratie wir uns wünschen und welche Änderungen damit einhergehen. Welche Anpassungen wollen wir vorantreiben und welche verhindern?
Denn: „Die Demokratie“ existiert nicht. Demokratie wird in verschiedenen Kulturen und Zeiten anders verstanden. Während es gemeinsame Grundlagen gibt, ist die Vorstellung einer homogenen Demokratievorstellung nicht der Wahrheit entsprechend.
Was macht die DeGeDe hier?
Es lässt sich festhalten, dass die Geschichte der Demokratie geprägt ist von Entwicklungen, die durch gesellschaftliche, politische und pädagogische Anstrengungen getragen wird. Als interdisziplinärer Fachverband und multiprofessionelles Netzwerk spielt die Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik e.V. (DeGeDe) eine zentrale Rolle. Ihr Anliegen ist es, demokratische Werte nicht nur zu lehren, sondern vor allem zu leben und erlebbar zu machen – in Schulen, Jugendarbeit und der gesamten Zivilgesellschaft. Denn, wie Theodor Eschenburg schrieb: „Demokraten fallen nicht vom Himmel.” Deshalb setzt sich die DeGeDe für die demokratische Ermächtigung von Kindern und Jugendlichen. Ihr Zugang erfolgt dabei über die Mikroebene – Demokratie als Lebensform. Sie legt großen Wert auf die Prävention von struktureller Diskriminierung und individueller Demütigung. Sie schafft Räume, in denen Kinder und Jugendliche lernen, Verantwortung zu übernehmen und sich als aktive Bürger*innen zu verstehen. Die Demokratiepädagogik der DeGeDe ist beziehungs- und erfahrungsorientiert und setzt auf ein pädagogisches Qualitätsverständnis, das Anerkennung in den Mittelpunkt stellt.
Durch ihre Arbeit leistet die DeGeDe einen unverzichtbaren Beitrag zur Stärkung einer lebendigen, partizipativen Demokratie, die sich fortlaufend erneuert und von der aktiven Mitgestaltung jedes Einzelnen lebt. So bleibt die Demokratie ein Projekt, das nicht abgeschlossen ist, sondern jeden Tag von Neuem gelebt werden muss.